Auch unser Leben bekommt mit Traditionen, Bräuchen und Riten eine Struktur, die wenig aneckt und millionenfach ausprobiert wurde. Wir Deutschen haben, wie jedes andere Volk, unsere eigenen Traditionen ausgebildet. So wird kaum jemand die Reihenfolge Taufe, Konfi, Abiball, Hochzeit, Leichenschmaus durcheinanderbringen. Ob es nun praktiziert wird oder nicht. Wir können es einordnen und darauf rausgeben. Wenn wir wissen, wo es langgeht und alle gehen mit, ist eine Menge geschafft. Kein Fest hat so viele Riten wie Weihnachten. Das Fest der Traditionen. Da gehen wir weit über unsere Schmerzgrenzen. Stichwort: Würstchen mit Kartoffelsalat. „Aber Papa, ich bin Veganer.“ „Nicht heute, Kind. Nicht an Weihnachten!“ Natürlich ist bei Weihnachten inzwischen nicht mehr jeder bibelfest. Fest der Liebe. Ja, ok. Aber warum nun ganz genau ihr Kinderlein in der stillen Nacht, heiligen Nacht zum Oh Tannenbaum oder zur Krippe in Bethlehems Stall kommen sollten, ist nicht mehr ganz klar. Eventuell ist ein Ros entsprungen. Egal. Hauptsache Driving home for Christmas. Yeah! Irgendjemand muss Oma holen. Ich nicht, ich war last Christmas dran. Was aber tun, wenn die organisierte Religion als Eventplaner, als Taktgeber ausfällt? Wer weiß schon noch, dass Christmette recht wenig mit Hackfleisch zu tun hat. Und was, wenn sich im Adventskalender nur 24 köstliche Bierspezialitäten aus aller Welt verstecken? Wer gibt Weihnachten den Sinn, die Struktur? Wie so oft: Das gute alte Fernsehen! Puh. Glück gehabt. Linear und – wir sind bei den Eltern – analog. Eventuell sogar terrestrisch. Zumindest bis wir den Router eingerichtet haben. Wir haben eine große Zahl von Weihnachtsfilmen, die seitens der Rezipienten immer noch ein wenig in Ost und West unterteilt sind. In den frischen Bundesländern ist Aschenbrödel der tradierte Festgottesdienst. Aschenbrödel ist, wenn Tschechen in den 1970ern – als die DDR noch einwandfrei war – im sächsischen Moritzburg Märchenfilme drehen. Und so sieht es dann auch aus. Aber wenn man viele Jahre im Dresdner Stollen verbracht hat, mag man das. Und im Westen? Sissi. Aber da ist jedes Wort zuviel. Keine Sorge, wir haben ja noch ein paar mehr Filme zur Auswahl: Tatsächlich… Liebe, der Grinch, Die Geister, die ich rief, Eine schöne Bescherung, Das Wunder von Manhattan undsoweiterundsoweiter. Das Grundrauschen der klassischen Weihnachtsfilme funkt eigentlich immer auf der gleichen Frequenz: Kaltherzige, egoistische Menschen erfahren rund um das Fest der Liebe unter Zuhilfenahme von reichlich Glöckchenmusik, was Familie, Freundschaft und Zusammenhalt bedeuten. Alle zusammen, alle glücklich. Beim Happy End wird abgeblendet. Das ist wirklich schön! Klingt aber auch ein wenig nach Sozialismus. Apropos Weihnachtsfilme: Wir überwinden ja gerade das postheroische Zeitalter. Daher braucht es Weihnachtsfilme, die andere Werte in den Vordergrund stellen. Grundidee: Weihnachten als individuelle Herausforderung, als Kampf des Einzelnen gegen finstere Mächte. Und Gewalt als Lösung. Klar, es sterben rechts und links ein paar Teilnehmer, aber am Ende steht der Held strahlend unterm Weihnachtsbaum. Versprochen ist versprochen lassen wir in dem Zusammenhang da mal als konsumkritische Komödie durchgehen. Aber bei Tödliche Weihnachten hört der Spaß auf. Und bei Stirb langsam hat er nie angefangen, Schweinebacke. Das sind natürlich keine Filme für die ganze Familie. Also braucht es eine kindgerechte Erzählweise. Und schon ist Kevin allein zu Haus. Die Parallelen zu Stirb langsam sind wirklich verblüffend. Tausche Plastiksprengstoff gegen die Farbeimerschaukel. Uzi gegen Murmeln. Aber sonst? Der Held stemmt sich gegen Schicksal und Schurken. Wenn alles und alle erledigt sind, darf auch die nichtsnutzige Verwandtschaft noch kurz ins Bild. Oh Gott, wir sind filmreif. Frohes Fest! Dies – und vieles mehr – in der 42. Folge von: Ungefährliches Halbwissen – The Last Missing Podcast
Show More
Show Less
 Jan 7 20261 hr and 13 mins
Jan 7 20261 hr and 13 mins Dec 17 20251 hr and 9 mins
Dec 17 20251 hr and 9 mins Dec 10 20251 hr and 7 mins
Dec 10 20251 hr and 7 mins Dec 3 20251 hr and 36 mins
Dec 3 20251 hr and 36 mins Nov 26 20251 hr and 31 mins
Nov 26 20251 hr and 31 mins Nov 19 20251 hr and 25 mins
Nov 19 20251 hr and 25 mins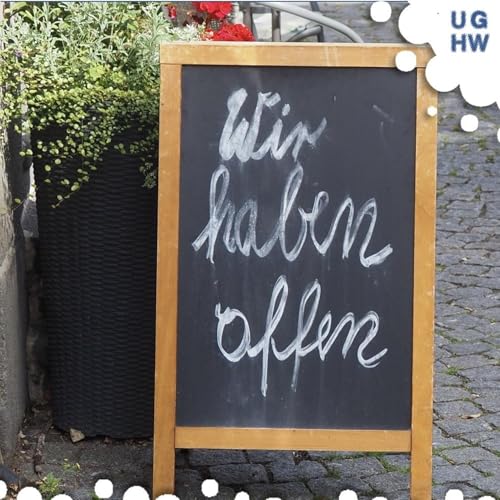 Nov 12 20251 hr and 25 mins
Nov 12 20251 hr and 25 mins Nov 5 20251 hr and 5 mins
Nov 5 20251 hr and 5 mins
